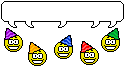Anne Idoux (Szenario) / Carine Borgi (Zeichnungen): La Promesse du Souffle (Rue de Sèvres 2025), 144 Seiten
1442 im Königreich Joseon, heute Korea. Unter König Sejong entsteht das Buch Hunminjeongeum, mit dem das koreanische Alphabet eingeführt wird.
Sandrine Revel: Tom Thomson - Esquisses d'un printemps (Dargaud 2019), 140 Seiten
Über den kanadischen Maler Tom Thomson (1877 - 1917)
Cyril Legrais (Szenario) / Alice V.D.M. (Zeichnungen): Les Oies Cendrées (Futuropolis 2025), 160 Seiten
Mit über 70 Jahren lebt der pensionierte Arthur in Schweden in einem kleinen Haus, wo der ehemalige Kunstprofessor in seinem Atelier malt und im See badet. Als in der zwanzig Jahre jüngere Gabriel, ein Galerist aus Paris, ihn besucht, verlieben sich die beiden.
Elisa Macellari: Kusama. Ossessioni, passione, arte (Gallucci Balloon 2025), 138 Seiten
Über Yayoi Kusama (Jahrgang 1929)
Fabrice Erre (Szenario) / Sylvain Savoia (Zeichnungen): Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino Tome 33. Le Louvre - Le plus grand musée du monde (Dupuis 2025), 32 Seiten
Kindersachcomic über den Louvre